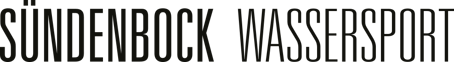
Fakten Verbrenner
90% weniger CO₂ aus normalen Dieselmotoren.
Was sind E-Fuels?
Als E-Fuels werden synthetische Kraftstoffe bezeichnet, die mit Strom aus regenerativen Quellen (z.B. Sonne oder Wind), CO2 und H2 hergestellt werden - und damit weitgehend klimaneutral sind. Einige dieser E-Fuels können als Ersatz für Benzin verwendet werden.
Welche Vorteile haben E-Fuels?
E-Fuels sind weitgehend klimaneutral, wenn für deren Herstellung Energie und Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen verwendet werden. Entsprechende E-Fuels können direkt in vorhandenen Benzin-Motoren verwendet werden, brauchen auch keine neue Infrastruktur. Reine E-Fuels (z.B. P1) sind auch schon in Außenbordern auf dem Bodensee problemlos erprobt worden.
Können E-Fuels mit Benzin gemischt werden?
In der Regel können E-Fuels, die für die Verwendung in Otto-Motoren vorgesehen sind, auch mit „normalem“ Benzin gemischt werden. Dies wird gezielt in gemischten Kraftstoffen (Blending) genutzt, um fossiles Benzin stufenweise mit E-Fuel anzureichern (aus Kosten- und Verfügbarkeitsgründen).
Haben E-Fuels Nachteile?
E-Fuels werden bisher nur in kleineren Anlagen in verschiedenen Verfahren hergestellt. Die Mengen sind noch begrenzt - und die Kosten entsprechend hoch. Mit größeren Anlagen lassen sich die Mengen steigern, die Kosten senken. Notwendig sind politische Weichenstellungen und Abnahmevereinbarungen mit den Herstellern. So hat etwa die Schifffahrt am Vierwaldstätter See mit dem Schweizer Start-up Synhelion einen langfristigen Liefervertrag geschlossen. Synhelion geht davon aus, dass bis 2030 ein Liter E-Fuel nur noch etwa einen Euro kosten wird.
Sind E-Fuels überhaupt verfügbar, was kosten sie und wo bekomme ich E-Fuels für mein Boot?
E-Fuels können dem konventionellen Benzin zugemischt werden. Zunächst aufgrund der Kosten ein kleinerer Anteil, bei später sinkenden Preisen stufenweise mehr.
Weltweit wird am Thema E-Fuels gearbeitet, da mit solchen „Drop-in-Fuels“ bestehende Infrastruktur und Motoren (die wiederum Kosten und CO2-Emissionen verursachen würden) weiter genutzt werden können. Eine ideale Lösung also für alle bestehenden Motoren.
Die Verfügbarkeit vom E-Fuels am Bodensee verbessert sich kontinuierlich. Noch 2025 sollen erste MtG-Kraftstoffe bei den Lieferanten für den Bodensee verfügbar sein. MtG steht für „Methanol to Gas“, also einem DIN-konformen Kraftstoff, der aus synthetisch erzeugtem Methanol hergestellt wird,
Ist das „E10“ an den deutschen Seetankstellen ein E-Fuel?
Nein, hier steht „E10“ für „echte“ zehn (Volumen-)Prozent Ethanol, die aus pflanzlichen Reststoffen stammen. Dieses „E10“ vermindert jedoch die CO2-Emissionen im Vergleich zu fossilem Benzin (Super Plus) um rund 8,5 Prozent. Beim E10 an der Straßentankstelle kann zwischen null und zehn Prozent Ethanol aus nicht definierten Quellen zugesetzt sein, die CO2- Ersparnis ist da also unbestimmt.
Machen E-Motoren für Boote am Bodensee überhaupt Sinn?
Diese Frage ist nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von E-Motoren für jede Leistung und Anwendung. Die Frage fokussiert sich eher auf die Batterie und damit Reichweite, Sicherheit - und auch die Kosten. Als kleiner Antrieb mit einer kleinen Batterie, die man mit nach Hause nehmen kann und dort wieder auflädt, kommt der E-Motor für viele kleine Boote, etwa für Angelboote oder als Flautenschieber kleiner Segelboote, durchaus in Frage. Doch für ein grösseres Boot bräuchte man auch einen grösseren E-Motor (gibt es natürlich) - und eine grössere Batterie. Doch da stösst man an physikalische und finanzielle Grenzen. Ausreichend grosse Batterien, um auch einmal gegen Wind und Welle zu fahren, wären schwer und entsprechend teuer. Also würde man die Dimension der Batterie reduzieren. Damit schrumpft nun aber die Reichweite. Man müsste also sehr genau kalkulieren, wie weit man kommt, ehe eine Batterie leer ist - und man zu Seenotfall wird.
Dazu kommt das Problem der Lademöglichkeiten. Rund um den Bodensee gibt es kaum Möglichkeiten, eine grössere Batterie am Steg nachzuladen. Was auf der Strasse so einfach scheint, ist am See einfach nicht möglich. Denn die meisten Ladepunkte an den Strassen sind mit Steuergeldern gefördert - und sie sind vor allem rund ums Jahr in Betrieb, um Umsatz (und letztlich Gewinn) zu generieren. Am Bodensee gibt es praktisch weder Fördergelder für Ladestationen noch eine Nachfrage rund ums Jahr. Selbst in den wenigen Sommermonaten ist die Nachfrage auf die Wochenend- und Feiertage beschränkt, wenn die Boote bewegt werden. Wer soll also in eine Ladestation investieren, wenn kein Gewinn in Sicht ist?
Aus der Perspektive eines Eigners sieht es ähnlich komplex aus. Mit durchschnittlich rund 30 Betriebsstunden pro Jahr kommt ein Freizeitboot niemals auf eine Betriebsdauer, die erforderlich wäre, um den Mehraufwand für die Produktion von Motor und Batterie zu kompensieren.
Schließlich haben wir auf dem Wasser einen bedeutenden physikalischen Unterschied zur Strasse: Während ein Auto nur den Rollwiderstand überwinden muss, hat ein Boot immer den erheblich grösseren Wasserwiderstand, der überwunden werden muss. Der lässt sich durch die Rumpfform (Katamaran, Gleiter) oder durch Tragflügel-Technik reduzieren. Damit gehen aber die Kosten enorm in die Höhe! Auch eine Rekuperation (Zurückspeichern der Energie beim Bremsen) findet bei Booten nicht statt.
Zu betrachten wäre auch, wie der Strom erzeugt wird. Ist es separat erzeugter Strom aus Solar-, Wind- oder Wasserkraftwerken? Oder wird er aus einer netzgebundenen Steckdose geladen, die letztlich mit dem Strommix versorgt wird (der in Deutschland einen erheblichen Anteil an Kohlestrom hat)?
Ein kompliziertes Thema. Wir halten fest: E-Mobilität auf dem Wasser ist lange nicht so vorteilhaft wie auf der Straße, dazu gibt es keine Fördermöglichkeiten für Fahrzeuge oder Lade-Infrastruktur auf dem See. Die Investition in einen neuen Motor und eine neue Batterie wird sich wirtschaftlich nie ausbezahlen. Eine Investition der gleichen Summe dagegen in energiesparende Haustechnik würde einen erheblich höheren Klimaeffekt haben!
Welche E-Motoren für Sportboote gibt es?
Modernere E-Motoren für Boote werden seit gut 20 Jahren angeboten. Heute reicht die Palette von rund 1 kW (1,3 PS) bis 50 kW, vereinzelt auch höhere Leistungen. Die Motoren sind oft als Außenborder konzipiert, zusehends aber auch als Innenborder. Wesentlich ist die jedoch die Kapazität der angebotenen Batterie für die Reichweite. Dazu kommt das Thema des Ladens der Batterie. Insbesondere „Flautenschieber“ für kleinere Segelboote sind inzwischen als E-Motoren weitgehend ausgereift. Bald ein Dutzend Hersteller offerieren E-Motoren für kleinere Boote. Die Akkus der kleineren Motoren kann man oft abnehmen und zuhause laden.
Werden E-Boote angeboten?
Natürlich werden auch komplette E-Boote angeboten, die speziell auf die Anforderungen eines E-Antriebs abgestimmt sind (wie etwa die Chill der Heinrich-Werft, die Twiel Z7 von MIZU oder die Delphia-Cruiser, auch die Candela C-8). Dazu gibt es Motorboote, die einfach nur einen E-Motor statt des Verbrenners einbauen - was aber wenig effektiv ist und sich in schlechter Effizienz und geringer Reichweite niederschlägt.
Welche Reichweite haben E-Boote?
Das ist in erster Linie von der Größe (Kapazität) der Batterie abhängig, ebenso vom Verbrauch pro gefahrene Strecke/Zeit.
Ein paar Beispiele: Der speziell für einen E-Antrieb (3 oder 6 kW) entwickelte Bootstyp „Chill“ der Heinrich-Werft ist mit einer 4,8 kWh-Batterie ausgestattet. Für eine Fahrt in Rumpfgeschwindigkeit von etwa sechs Knoten (bei glattem Wasser, ohne Gegenwind) braucht das Boot dafür eine Leistung von etwa einem kW. Nach knapp fünf Stunden wäre also die Batterie absolut leer (sollte man nicht machen, um der Batterie nicht zu schaden), was einer Strecke von 30 Seemeilen (rund 50 km) entspricht. Reserven? Keine in diesem Beispiel. Es darf da also nichts dazwischen kommen - kein Wind, keine Welle, keine sonstigen Ereignisse.
Die auf einen 300 kW starken E-Motor umgerüstete Performance e801 eines Unternehmens in Bodenseenähe dagegen schafft zwar eine Geschwindigkeit von über 30 Knoten. Doch die beiden 63 kWh großen Batterien wären nach gut 20 Minuten leer …
Was kosten Boote mit E-Antrieb?
Die Antwort ist einfach: Viel! Viel mehr als ein gleichwertiges Boot mit Verbrennungsmotor.
Das Magazin „Traumboote“ der IBN (März 2025) hat verschiedene E-Boote getestet und die Kosten aufgelistet:
Chill (Heinrichwerft, 6 m lang) 68.500 CHF zzgl. Steuer
Candela C8 (Candela, 8,5 m lang) rund 330.000 Euro zzgl. Steuer
FrauscherXPorsche eFantom (Frauscher, 8,7 m lang) ca. 550.000 Euro zzgl. Steuer
Den Tender 06 (Heinrichwerft) gibt es mit einem 70 PS Benzin-Außenborder für knapp 70.000 CHF, mit einem elektrischen Molabo-Außenborder (50 kW) und 36 kWh-Batterie rund 129.000 CHF, jeweils zzgl. Steuer.
Was ist, wenn die Batterie eines E-Bootes leer ist?
Dann hat man in den meisten Fällen Pech gehabt und kann nur noch Schlepphilfe anfordern. Denn während man auf einem Boot mit Verbrennungsmotor einfach aus einem Reservekanister nachtanken kann, würde eine „Reserve-Batterie“ mit sehr hohen Kosten und relativ hohem Gewicht zu Buche schlagen. Nur bei Hybrid-Antrieben (Verbrenner und E-Motor) könnte man mit dem konventionellen Motor weiter fahren oder die Batterie wieder laden.
Kann man einen E-Motor als Flautenschieber/Hilfsantrieb für ein Segelboot einsetzen?
Ja, für Hafenmanöver oder Flautenschieber bei nicht allzu weiten Strecken ist ein kleiner E-Motor eine interessante Alternative. Man muss sich aber der begrenzten Leistung und Reichweite bei schwerem Wetter bewusst sein. Die Kraft und Ausdauer eines Dieselantriebs, um bei starkem Wind oder gar Gewitter über den See zu fahren, haben die E-Antriebe meistens nicht. Vorausschauende Seemannschaft ist hier in besonderem Masse erforderlich!
Kann man die Kapazität einer Batterie zu 100 Prozent nutzen?
Auch wenn eine Lithium-Batterie eine bessere nutzbare Kapazität hat als frühere Akkus, so sollte man sie nie ganz leer fahren und auch nur dann zu 100 Prozent laden, wenn man gleich danach losfährt. Empfohlen wird von allen Batterie-Herstellern ein „Komfort-Bereich“ von 20 bis 80 Prozent der Kapazität. Alles andere verkürzt die Lebensdauer einer Batterie. Umgekehrt heißt das aber auch, dass für Reichweiten-Abschätzungen nicht 100 Prozent der angegebenen Kapazität herangezogen werden dürfen.
Kann man mit E-Booten auch Wasserski fahren?
Ja, für kurze Zeit, wenn der Motor stark genug ist und das Boot dabei schnell genug fährt. In den meisten Fällen reicht die Batterie dann aber nur für etwa eine halbe Stunde Fahrspaß. Tatsächlich kennen wir nur PR-Fotos von Wasserskifahrern, um die erreichte Geschwindigkeit zu demonstrieren. Auf dem Bodensee haben wir noch keine privaten E-Boote mit Wasserskifahrern gesehen.
Wo kann ich am Bodensee die Batterien wieder aufladen?
Bisher haben nur wenige Unternehmen am See werkseigene Lade-Möglichkeiten. Eine öffentlich zugängliche Ladestationen ist uns nur in Friedrichshafen (Yachthafen des WYC) bekannt. Beim BMK-Yachthafen in Langenargen ist eine Ladestation geplant (Stand April 2025).
Über weitere Ladestationen am Bodensee für Boote werden wir berichten, sobald sie uns bekannt sind.
Wie lange muss ich laden?
Wenn Sie an einer Steg-Steckdose, die mit 6 Ampere abgesichert ist (wie in vielen Häfen am Bodensee), Ihre Batterie aufladen, so erhalten Sie da eine Leistung von knapp 1,4 kW (6 A x 230 V = 1380 Watt). Das Ladegerät braucht etwa zehn Prozent, so dass Sie Ihre Batterie mit etwa 1,2 kW laden. Nach drei Stunden haben sie einen kleinen Akku mit 3,6 kWh geladen und die Batterie beispielsweise der Chill (Kapazität 4,8 kWh) von fast leer auf fast voll gebracht. Um eine größere Batterie (36 kWh) von 20 auf 80 Prozent zu laden, brauchen Sie 22 kWh, also 18 Stunden. Dabei dürfen Sie keinen anderen starken Verbraucher an Bord (Wasserkocher, Toaster, Fön) mehr einschalten, da sonst die Sicherung am Steg rausfliegt.
An einer Ladestation mit einer Wallbox und einer Leistung von 11 kW können Sie auch größere Batterien nachladen. Sofern Ihr Boot diese Leistung verträgt, sind nach gut zwei Stunden die 22 kWh aus unserem Beispiel oben nachgeladen. An einer Schnellladestation, wie sie an den Strassen stehen, könnte man mit rund 100 kW laden. Sollte Ihr Boot das vertragen, sind die oben erwähnten 22 kWh in einer Viertelstunde nachgeladen. Allerdings sehen wir am Bodensee nicht einmal Planungen für eine maritime Schnellladestation.
Hilft ein Tempolimit auf dem Bodensee dem Klima – oder spart es Sprit?
Kurz gesagt: Nein.
Ein Umweltverein fordert ein Tempolimit von 15 km/h für fossil betriebene Motorboote auf dem Bodensee. Rund 90 % der Boote, die schneller fahren können, sind Gleiter. Diese sind so konstruiert, dass sie in Gleitfahrt weniger Energie und damit weniger Kraftstoff verbrauchen, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Zudem verursachen sie in Gleitfahrt weniger Lärm und erzeugen kleinere Wellen als bei langsamer Fahrt.
Wird ihre Geschwindigkeit künstlich gedrosselt, können sie nicht mehr gleiten. Der Wasserwiderstand steigt dadurch erheblich – und der Kraftstoffverbrauch pro Kilometer nimmt zu statt ab.
Verdrängerboote hingegen fahren ohnehin langsamer als 15 km/h (typisch etwa 8 kn). Ein generelles Tempolimit würde daher keine nennenswerte Treibstoffersparnis bringen.
Welche Folgen hätte ein Verbot von Verbrenner-Motoren am Bodensee?
Vereinzelt werden Forderungen nach einer Beschränkung von Verbrenner-Motoren bei Neuzulassungen auf dem Bodensee laut.
Aus Sicht des Klimaschutzes wäre der Effekt gleich null. Die Verkaufszahlen von Motorbooten sind in jüngster Zeit stark eingebrochen. Treffen würde es aber auch Segelyachten, die von einem Hilfsmotor angetrieben werden.
Keinen Einfluss hätte ein Verbot neuer Verbrenner-Motoren auf die Bestandsflotte.
Ein Verbot neuer, effizienter und umweltfreundlicherer Verbrenner-Motoren würde erneut dazu führen, dass bestehende Motoren für alle Zeiten immer wieder repariert und nie erneuert werden. In der Regel wird aber durch den Kauf eines neuen Motors oder Bootes ein altes ausgemustert – die Emissionswerte werden dadurch also verbessert.
Erheblich effektiver ist der Ersatz fossiler Kraftstoffe durch klimafreundliche Kraftstoffe wie HVO statt Diesel und in naher Zukunft E-Fuels statt Benzin, die als Drop-in-Fuels ohne weitere Maßnahmen an Infrastruktur und Motor sofort einsetzbar sind und bis zu 90 Prozent CO₂ einsparen (HVO).
Was hilft dem Klima aus Sicht der Wassersportler?
Der Einsatz von Drop-in-Fuels würde sofort Wirkung zeigen. Bei HVO statt Diesel sind das rund 90 Prozent geringere CO₂-Emissionen. E-Fuels stehen künftig in immer größeren Mengen zur Verfügung und können wie HVO in fast allen vorhandenen Motoren eingesetzt werden. HVO ist bereits an mehreren Seetankstellen erhältlich.
Welche alternativen Kraftstoffe und Motoren sich in der Entwicklung durchsetzen werden, wird sich zeigen. Der Nischenmarkt am Bodensee wird jedenfalls nicht die Entwicklung von Motoren weltweit beeinflussen.
Was ist HVO?
HVO ist die Abkürzung für „Hydrotreated Vegetable Oil“, also hydriertes Pflanzenöl. Dieser Kraftstoff entspricht den Vorgaben der DIN EN 15940 für Diesel-Kraftstoff und kann daher in allen Dieselmotoren eingesetzt werden. HVO wird zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen wie Abfällen und Reststoffen hergestellt.
Welche Vorteile hat HVO?
HVO spart aufgrund seiner Herstellung aus erneuerbaren Rohstoffen rund 90 Prozent CO2 gegenüber fossilem Diesel. Dazu wird auch „grüner“ Strom verwendet.
HVO hat eine hohe Cetanzahl und ist daher ein hochqualitativer Diesel-Ersatzkraftstoff, der sehr effizient und sauber verbrennt.
HVO enthält keine Schwefel-Verbindungen und keine aromatischen Kohlenwasserstoffe, ist daher auch nur nach Wassergefährdungsklasse WGK 1 eingestuft (und riecht auch nicht so typisch wie Diesel). Ein Verschütten ist daher lange nicht so dramatisch wie bei klassischem Diesel. HVO ist biologisch abbaubar.
HVO zieht kein Wasser an und ist daher immun gegen Dieselpest.
HVO ist auch kein „Bio-Diesel“ wie die bisher bekannten Rapsöl-Produkte und ähnliche, sondern ist eher als synthetischer Diesel zu bezeichnen. HVO (wie es an den Seetankstellen verkauft wird) ist bis zu minus 22 Grad kältebeständig - kann also auch im Winterlager im Boot blieben.
HVO erfüllt die Norm DIN EN 15940 für paraffinische Dieselkraftstoffe, kann also statt Diesel ohne Änderungen an Motor, Tank oder Tankstelle eingesetzt werden. HVO ist ein „Drop-in“-Kraftstoff.
Kann ich HVO einfach so tanken und fahren?
Ja, HVO kann in jedem Verhältnis mit konventionellem Diesel gemischt werden. Der Tank muss also vorher nicht leer gefahren werden. Um der Dieselpest den Garaus zu machen, sollte der Tank (sofern gewöhnlicher Tankstellen- oder Bio-Diesel drin war) allerdings schon einmal ziemlich leer sein.
Hat HVO auch Nachteile?
Hm, wir wissen von keinen Nachteilen! Es stinkt nicht wie Diesel, ist gut für den Motor und die Umwelt - wo ist da ein Nachteil?
Ist in HVO Palmöl drin?
Rein technisch könnte man auch Palmöl für die Herstellung von HVO einsetzen - aber das bringt dem Klima ja gar nichts. In der EU ist daher Palmöl als Rohstoff für HVO nicht zugelassen!
Was passiert beim Verschütten von HVO?
HVO enthält keine aromatischen Kohlenwasserstoffe oder schwefelhaltigen Verbindungen, die sonst den typischen Geruch von fossilem Diesel verursachen. Daher ist es nur in die Wassergefährdungsklasse WGK 1 eingestuft. HVO ist biologisch abbaubar. Verschüttetes HVO nimmt man trotzdem mit geeigneten Absorptionsmitteln auf. Gelangt unverbranntes HVO mit dem Abgas in den See, so ist dieses im Vergleich zu fossilem Diesel schon fast belanglos. Trotz aller motorisierten Boote auf dem Bodensee hat das Wasser Trinkwasserqualität - und mit HVO reduziert sich der Eintrag potenzieller Schadstoffe.
Was kostet HVO?
HVO kostet nicht wirklich spürbar mehr als klassischer Diesel. Bei Ultramarin werden an der Tankstelle für HVO (dort gibt es HVO schon seit 2023) wie auch für Superbenzin etwa 20 Cent mehr verlangt, was mit dem höheren Aufwand für eine Seetankstelle zusammenhängt.
Mit HVO spart man sich auch die Kosten für Zusatzstoffe gegen Dieselpest. Und das Klima sollte einem doch etwas wert sein.
Wie lange hält sich HVO im Tank?
HVO altert deutlich langsamer als herkömmlicher Diesel – ist also perfekt für Boote, die nur wenige Betriebsstunden haben und den Kraftstoff entsprechend lange im Tank haben. HVO zieht auch kein Wasser an.
Wo gibt es HVO?
An der Seetankstellen von Ultramarin in Kressbronn-Gohren, in Wallhausen (Bodenseenautic) und bei Konstanz im Seerhein am Pulverturm (ehemals MIZU). Die Schweizer Seetankstellen (Romanshorn, Bottighofen, Arbon) wollen ebenfalls HVO einführen. Der Zeitpunkt war Ende April 2025 noch nicht festgelegt.
An Land verkaufen im Bodensee-Umland derzeit nur die Schindele-Tankstellen HVO der Allgemeinheit an Zapfsäulen. Dort muss aber auf die Wintertauglichkeit geachtet werden, die bei HVO der Seetankstellen ganzjährig gewährleistet ist.
Gibt es genug HVO für alle Dieselmotoren am Bodensee?
Kein Problem. Die Lieferanten könnten sämtliche Tankvolumina am Bodensee mit HVO versorgen.
Welche alternativen Kraftstoffe gibt es neben HVO und E-Fuels?
Die Zutaten für alternative, nachhaltige Kraftstoffe sind: „gruener“ Strom, Wasser und CO₂. Daraus kann man je nach Verfahren Wasserstoff (H₂), Methanol und andere Kohlenwasserstoffe herstellen. Mittels Trennverfahren (wie in einer Raffinerie) werden verschiedene, mehr oder weniger sortenreine Kraftstoffe produziert.
Ist (grünes) Methanol am See verfügbar, jetzt oder künftig?
Methanol ist eine einfache Massenchemikalie, die in sehr grossen Mengen zu günstigem Preis produziert wird. Nachhaltig ist nur „gruen“ (z. B. mit Sonnen- oder Windenergie) hergestelltes Methanol – das jedoch genauso knapp ist wie andere E-Fuels. Bisher kann man am Bodensee gruenes Methanol höchstens über den Chemikalienhandel oder gleich als ganzen Tankwagen vom Hersteller beziehen. Daran wird sich auch nichts ändern, da es keine Nachfrage für Methanol am Bodensee gibt.
Einen anderen Weg gehen Kraftstoffhersteller, die Methanol für die Synthese von Otto-Kraftstoff (→ E-Fuels) einsetzen.
Gibt es Methanol-Motoren für Sportboote?
Nein. Methanol-Motoren werden nur in sehr grossen Dimensionen für Handelsschiffe auf dem Meer entwickelt und angeboten. Die kleinsten liegen derzeit bei etwa 800 PS Leistung – erheblich mehr, als jedes Sportboot am Bodensee braucht. Serienmässige Methanol-Motoren von 5 bis 200 PS für Sportboote hat weltweit kein Hersteller im Angebot. Es werden (Stand 2025) auch keine solchen entwickelt.
Kann man alte Motoren auf Methanol umrüsten?
Mit ein paar Tricks wie aufgebohrten Einspritzdüsen, stärkeren Kraftstoffpumpen und vielem mehr könnte man einen Motor auf Methanol umrüsten. Doch gemäss Bodenseeschifffahrtsordnung (BSO) wäre nach dem Umbau ein aufwändiges Zulassungsverfahren notwendig, das für jeden Motorentyp einzeln durchlaufen werden müsste.
Mit den Kosten für ein solches Vorhaben könnte man selbst zu den jetzigen Preisen eine Menge E-Fuels kaufen.
Was kann man sonst mit Methanol machen?
Aus Methanol können E-Fuels für die Verwendung als Ersatzkraftstoff (MtG) in Otto-Motoren hergestellt werden. Wird „gruenes“ Methanol verwendet, reduziert dies auch die CO₂-Emissionen.
MtG-Kraftstoffe werden voraussichtlich dem Benzin zunächst in kleinen Mengen zugesetzt, um schrittweise eine Balance zwischen Kosten und Nutzen fürs Klima zu erzielen. Sobald grössere Mengen zu kleineren Preisen verfügbar sind, kann der Anteil von E-Fuels im Kraftstoff gesteigert werden. Vorteil: Die bestehende Infrastruktur und vorhandene Motoren können ohne Änderungen weiter verwendet werden. Eine teure Neuentwicklung von Infrastruktur und Motoren ist nicht notwendig.
Und wie steht es um Wasserstoff?
Wasserstoff wird als Energieträger in verschiedenen Projekten erforscht. Auf dem Bodensee gab es vor über 20 Jahren schon eine mit Wasserstoff ausgerüstete Segelyacht. Auch die Frauscher-Werft in Österreich hatte Wasserstoff schon im Portfolio. Aber beide Projekte sind aufgrund der komplexen Anforderungen an die Wasserstoff-Technologie bald wieder eingestellt worden. Wasserstoff erfordert ein hochprofessionelles Handling und aufwändige Technik (sehr hoher Druck, extreme Explosionsgefahr). Zudem ist für Wasserstoff eine spezielle Infrastruktur notwendig, die es am Bodensee nicht gibt – und die aufgrund der speziellen Situation vieler Häfen in historischen Altstädten niemals realisiert wird.
Die Nachfrage nach Wasserstoff-Motoren am Bodensee wird niemals eine solche Dimension erreichen, dass es sich lohnen würde, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen.
Gibt es Wasserstoff-Motoren für Sportboote?
Einen Wasserstoff-Aussenborder hat 2024 Yamaha als erster Hersteller für Bootsmotoren als Vision vorgestellt. Damit verbunden war aber auch ein völlig neu konstruierter Bootsrumpf. Denn Wasserstoff benötigt erheblich grössere Tankvolumina als konventionelle Kraftstoffe. Bis solche Projekte serienreif sind, wird noch viel Zeit vergehen.
Was ist Synhelion?
Das Schweizer Startup Synhelion (Zürich) wandelt Sonnenlicht in Kraftstoff um. Dazu betreibt es eine Pilotanlage in Jülich (Deutschland). Synhelion erzeugt aus Bioabfällen, Licht und Wasser ein synthetisches Rohöl, das wie gewohnt in einer Raffiniere in die Bestandteile Kerosin (SAF), Benzin (e-Fuel) und (Solar-)Diesel getrennt werden kann.
Als „Drop-in-Fuels“ können die in einer Raffinerie getrennten Kraftstoffe ohne weitere Massnahmen in entsprechenden Motoren oder Turbinen eingesetzt werden. Die Pilotanlage „DAWN“ ist in Jülich (zwischen Köln und Aachen) seit Juni 2024 in Betrieb. „Showcases“ (Flugzeug, Dampfschiff, Auto) zeigen, dass die jeweiligen Kraftstoff problemlos verwendet werden können.
Wie produziert Synhelion? Was ist DAWN?
Viele Verfahren, die Sonnenenergie in speicherbare Energie umwandeln, erzeugen erst Strom, spalten dann damit Wasser und produzieren Wasserstoff, der in weiteren Prozessschritten in flüssige Energieträger umgewandelt wird.
Synhelion geht einen anderen Weg: In der DAWN-Anlage in Jülich (bezuschusst von der deutschen Bundesregierung) wird Sonnenlicht direkt für die Produktion eines Rohöl-ähnlichen Gemischs eingesetzt. Eine Vielzahl von Spiegeln (218) bündelt das Sonnenlicht und erzeugen die Hitze für einen thermochemischen Reaktor. Darin werden bei 1200°C das Biogas und Wasser zu Wasserstoff H2 und Kohlenmonoxid CO umgewandelt. Dieses „Synthesegas“ reagiert in einem Fischer-Tropsch-Prozess weiter zu einem Kraftstoffgemisch, das als synthetisches Rohöl („SynCrude“) später in einer Raffinerie in die nutzbaren Komponenten Benzin, Diesel und Kerosin (SAF) getrennt wird. Die Anlage ist so ausgelegt, dass sie überschüssige Hitze speichert oder Strom aus der zugehörigen PV-Anlage nutzt, um rund um die Uhr die nötige Temperatur in dem Thermoreaktor zu liefern. So kann kontinuierlich produziert werden. Die Speicherung der Wärme ist effektiver als die Speicherung elektrischer Energie in Batterien - ein Schlüsselfaktor für das Synhelion-Verfahren. Das eingesetzte Biogas ist eine aus RED-zertifizierten Bio-Abfällen resultierende Mischung aus Methan CH4 und Kohlendioxid CO2. RED (Renewable Energy Directive) ist die Richtlinie der EU für erneuerbare Energie, die insbesondere regelt, welche tatsächlichen Rohstoffquellen als nachhaltig anerkannt werden (um z.B. frisches Palmöl auszuschliessen).
Im Juni 2024 war die DAWN-Anlage betriebsbereit. Seit September 2024 produziert sie das synthetische Rohöl. Seit April 2025 erreicht sie nahezu durchgehend die geplante Kapazität von „mehreren tausend Litern“ pro Jahr. Mit mehreren strategischen Partnern sind langjährige Abnahmeverträge geschlossen.
Vorteil des Synhelion-Prozess: Die sonst übliche Methode, Solarenergie in Strom umzuwandeln und damit Wasser zu Wasserstoff zu spalten und weiter zu verarbeiten, ist mehrstufig und jedesmal mit Umwandlungsverlusten belastet. Bei Synhelion wird die solare Energie direkt für die Erzeugung des Synthesegases verwendet - mehrere Umwandlungsverluste entfallen somit bei Synhelion.
Die Produkte (Solar-Benzin, Solar-Diesel oder SAF) können als Drop-in-Fuels direkt als Ersatz für fossile Kraftstoffe eingesetzt werden - und tragen so erheblich zur Einsparung von CO2-Neuemissionen bei.
SAF von Synhelion für SWISS
Synhelion lieferte Ende Juli 2025 das erste Fass mit einem SAF-Treibstoff an die Fluggesellschaft SWISS (Lufthansa Group). In der Produktionsanlage DAWN (in Jülich) wird der Rohstoff für das SAF aus Biogas und Wasser bei hohen Temperaturen und unter Druck hergestellt. Die nötige Energie liefern Hunderte von Spiegel, die Licht auf den Reaktor bündeln. Das entstehende synthetische Rohöl wird in einer Raffinerie in Norddeutschland verarbeitet, u.a. zu zertifiziertem Flugtreibstoff Jet-A-1.
Aus dem 190 Liter Fass mit dem Rohstoff „Syncrude“ wurden 97 Liter synthetisches Kerosin gewonnen. Das ist nur eine symbolische Menge - demonstriert aber die Funktionsfähigkeit des Verfahrens. Das gelieferte SAF ersetzt etwa vier Prozent des benötigten Treibstoffs für einen Flug von Hamburg nach Zürich. Klingt nach wenig, ist aber nach Angaben von Synhelion „ein echter Meilenstein“.
Wichtig war es für Synhelion, zu zeigen, dass sich deren Produkte „nahtlos“ in den Raffinerie-Prozess integrieren lassen - eine Voraussetzung für die Skalierbarkeit der Methode in industrielle Dimensionen.
SWISS ist seit 2022 Investor bei Synhelion, unterstützt mit der Muttergesellschaft Lufthansa Synhelion als strategischer und operativer Partner in der Markteinführung. SWISS wird derzeit unregelmässig mit SAF versorgt, plant aber einen regelmässigen Bezug, sobald ein solcher kommerziell möglich ist (ab ca. 2027).
www.synhelion.com/technology
Solar-Diesel von Synhelion für Dampfschiff GALLIA
Im Mai 2025 wurde erstmals auf dem Vierwaldstättersee Solar-Treibstoff von Synhelion in einem Dampfschiff eingesetzt. Die „Gallia“ wurde mit ein Fass Solar-Diesel aus der Pilotanlage DAWN von Synhelion betankt. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) plant, künftig regelmässig Solartreibstoff von Synhelion zu beziehen und hat dafür bereits einen fünfjährigen Abnahmevertrag unterzeichnet. Als Pionierkundin leistet die SGV einen wichtigen Beitrag zur Skalierung der Technologie von Synhelion. Ab 2027 soll die „Gallia“ vollständig mit Solardiesel betrieben werden.
Solar-Benzin von Synhelion für einen Oldtimer
Anfang Juli 2025 meldete Synhelion, erstmals einen Oldtimer mit solar produziertem Ottokraftstoff betankt zu haben. Ein Audi Sport Quattro aus dem Jahr 1985 wurde mit dem Solar-Benzin von Synhelion versorgt. An dem 306 PS starken Motor wurden keinerlei Veränderungen vorgenommen. Der Audi führte eine Oldtimer-Rallye über Schweizer Alpenpässe problemlos an. Der Fahrer habe keinen Unterschied zu fossilem Benzin bemerkt.
Zuvor war das Solar-Benzin von Synhelion schon erfolgreich in einem Motorrad getestet worden.
Wie sind die Erfahrungen der Kunden mit den synthetischen Kraftstoffen?
„Unspektakulär“, sagt Synhelion. In den bisherigen „Showcases“ (SAF für SWISS, Solar-Diesel für Dampfschiff GALLIA, Solar-Benzin für PKW und Motorrad) wurden keine Unterschiede zum regulären Betrieb festgestellt - wie das auch für „Drop-in-Fuels“ zu erwarten war.
Kann man Solar-Kraftstoffe von Synhelion kaufen?
Synhelion beliefert derzeit unregelmässig „strategische“ Partner mit den Solar-Kraftstoffen. Kommerziell erhältlich sind diese nicht. Auch die Bezuschussung der Demonstrationsanlage in Jülich mit deutschen Steuergeldern steht einer kommerziellen Vermarktung im Wege, heisst es in Insider-Kreisen.
Wie geht es bei Synhelion weiter?
Die bisherige Anlage in Jülich ist eine Demonstrationsanlage, um die Funktionsfähigkeit der Technologie zu beweisen und Erfahrungen zu sammeln. Die auch mit deutschen Steuergeldern geförderte Anlage DAWN in Jülich darf nicht kommerziell am Markt auftreten. Die produzierten Kraftstoffe sind daher strategischen und mitfinanzierenden Partnern vorbehalten.
Eine grössere, gewerbliche Anlage namens „Shine“ plant Synhelion inzwischen in unmittelbarer Nachbarschaft der Pilotanlage. Die Pläne für eine Anlage in Spanien wurden aufgegeben. „Shine“ soll eine Kapazität von 100.000 Tonnen Treibstoff pro Jahr haben und bis 2030 in Betrieb gehen. Synhelion strebt langfristig ein Preisniveau von 1 CHF je Liter an. „Unser Ziel sind Produktionskosten, die mit anderen nachhaltigen Treibstofftechnologien wettbewerbsfähig sind“, heisst es bei Synhelion.