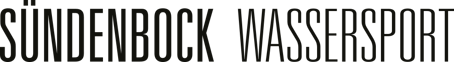
Eine kleine Gruppierung fordert ein sofortiges Verbot von Verbrennungsmotoren für Boote am Bodensee.
Was sie nicht mit einberechnen: Ein Motorboot fährt pro Jahr durchschnittlich rund 30 Stunden, ein Segelboot ist im gleichen Zeitraum nur rund 16 Stunden mit Motor unterwegs. Daher muss man, unabhängig von der Technologie, zwingend den CO2-Ausstoss der Motorenproduktion mit einberechnen. Allein dieser sorgt bei einem Ersatz über viele Jahre für eine negative Klimabilanz.
Verbietet man am Bodensee neue Verbrennungsmotoren, verhindert man damit auch die sofort umsetzbaren Lösungen zur CO₂-Reduktion, für die bereits die nötige Infrastruktur besteht.
Statt herkömmlichem Diesel kann HVO («Hydrotreated Vegetable Oil», mit Wasserstoff behandeltes Pflanzenöl aus Abfallstoffen) getankt werden. Das reduziert den CO2-Ausstoss im Vergleich zu normalem Diesel um etwa 90 %. HVO kann in allen Dieselmotoren eingesetzt werden und ist schwefelfrei. HVO kann in beliebigem Verhältnis mit herkömmlichem Diesel gemischt und an ganz normalen Tanksäulen getankt werden. HVO ist auch keine Zukunftsmusik: An der Seetankstelle in Kressbronn wird seit 2023 nur noch HVO-Diesel verkauft. Die Akzeptanz ist hoch und die Preise liegen auf ähnlichem Niveau wie bei Diesel. In der Schweiz ist HVO an öffentlichen Tankstellen auch Ende 2024 immer noch nicht erhältlich – das muss sich ändern.
Auch für Benzinmotoren existieren Ersatzkraftstoffe, die ohne Anpassungen eingesetzt werden können. Klimafreundliche E-Fuels sind am Bodensee erprobt und dank zunehmender Produktion ist mit sinkenden Preisen zu rechnen. Unter E-Fuels versteht man synthetische Treibstoffe, die mittels Wind- oder Sonnenenergie aus Wasser und CO2 hergestellt werden. Das CO2 wird der Atmosphäre oder aus Biomasse entnommen. Da bei der Wind- und Solarenergie kein CO2 entsteht, ist der Treibstoff vollständig klimaneutral. Gerade für Sportboote sind E-Fuels der Treibstoff der Zukunft und es wird keine neue Infrastruktur benötigt. Bei den Tankstellen am See wäre eine Zumischung von E-Fuels mit stufenweiser Steigerung nach Verfügbarkeit denkbar – ein Kosten-Nutzen-Kompromiss für die Klimabilanz, der stufenweise umgesetzt zum Ziel führt.
Für kleinere Boote und als Flautenschieber bei Segelbooten ist ein elektrischer Antrieb eine gute Alternative und wird schon heute vielfach eingesetzt. Bei den Personenwagen zeichnet sich immer mehr der batteriebasierte Elektroantrieb als abgasfreie Lösung für unsere Mobilität ab. Bei Schiffen und Booten ist die Sache etwas komplizierter. Stand heute bräuchte ein Gleiter-Motorboot eine sehr grosse Batterie, um vorwärtszukommen, und würde dennoch nach kurzer Zeit schlappmachen. Batterien benötigen sehr viel Energie bei der Herstellung – und das alles für durchschnittlich 30 Betriebsstunden pro Jahr! Ausserdem existiert am Bodensee keine Ladeinfrastruktur und wäre bei den vielen Bojenplätzen am See auch nicht realisierbar.
Auf dem Bodensee gilt bereits heute ein Tempolimit von 40 km/h. Der Verein «heurekaLAGO» setzt sich jedoch energisch für ein Tempolimit von 15 km/h ein und begründet dies mit einer angeblich hohen Treibstoffersparnis. Ein solches Tempolimit schadet aber der Umwelt. Motorboote, die 40km/h fahren können, sind sogenannte Gleiter. Sie heben sich bei Geschwindigkeiten ab 20 bis 30 km/h aus dem Wasser und verbrauchen durch den reduzierten Widerstand deutlich weniger Treibstoff pro zurückgelegtem Kilometer. Relevant ist die Reichweite, und nicht der Verbrauch je Stunde. Jeder Motorbootbesitzer fährt, um ein Ziel zu erreichen: ins Restaurant, zum Baden, zu einem Ankerplatz. Wie die unten stehenden Grafik zeigt, benötigt ein Motorboot in Gleitfahrt wesentlich weniger Treibstoff pro zurückgelegtem Kilometer. Ein Motorboot macht übrigens in Gleitfahrt auch weniger Lärm und Wellen.

Was ist HVO?
HVO ist die Abkürzung für „Hydrotreated Vegetable Oil“, also hydriertes Pflanzenöl. Dieser Kraftstoff entspricht den Vorgaben der DIN EN 15940 für Diesel-Kraftstoff und kann daher in allen Dieselmotoren eingesetzt werden. HVO wird zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen wie Abfällen und Reststoffen hergestellt.
Welche alternativen Kraftstoffe gibt es neben HVO und E-Fuels?
Die Zutaten für alternative, nachhaltige Kraftstoffe sind: „gruener“ Strom, Wasser und CO₂. Daraus kann man je nach Verfahren Wasserstoff (H₂), Methanol und andere Kohlenwasserstoffe herstellen. Mittels Trennverfahren (wie in einer Raffinerie) werden verschiedene, mehr oder weniger sortenreine Kraftstoffe produziert.
Was ist Synhelion?
Das Schweizer Startup Synhelion (Zürich) wandelt Sonnenlicht in Kraftstoff um. Dazu betreibt es eine Pilotanlage in Jülich (Deutschland). Synhelion erzeugt aus Bioabfällen, Licht und Wasser ein synthetisches Rohöl, das wie gewohnt in einer Raffiniere in die Bestandteile Kerosin (SAF), Benzin (e-Fuel) und (Solar-)Diesel getrennt werden kann.
Als „Drop-in-Fuels“ können die in einer Raffinerie getrennten Kraftstoffe ohne weitere Massnahmen in entsprechenden Motoren oder Turbinen eingesetzt werden. Die Pilotanlage „DAWN“ ist in Jülich (zwischen Köln und Aachen) seit Juni 2024 in Betrieb. „Showcases“ (Flugzeug, Dampfschiff, Auto) zeigen, dass die jeweiligen Kraftstoff problemlos verwendet werden können.
Das Miteinander von Wassersportlern, am Bodensee ist grundsätzlich ein harmonisches. Damit das auch so bleibt, wollen wir an die Regeln der Rücksichtnahme und guter Seemannschaft erinnern und die Bootsfahrer weiter sensibilisieren. Wir gehen hier nicht auf technische Seemannschaft (von Knoten über Manöver bis Wetterkunde) oder Etikette (Flaggengebräuche, Bekleidung im Hafen) ein. Nur ein paar Selbstverständlichkeiten seien noch einmal erwähnt.
Vom Ankerplatz oder der Hafeneinfahrt fahren wir mit maximal 10 km/h (etwa 5 Knoten) senkrecht zum Ufer Richtung See.
Erst 300 Meter vom Ufer entfernt (da brauchen wir bei 10 km/h etwa zwei Minuten) darf die Geschwindigkeit gesteigert werden.
Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Bodensee ist auf 40 km/h (21,5 Knoten) limitiert - auch wenn das Boot schneller fahren könnte.
In Parallelfahrt zum Ufer halten wir einen Mindestabstand von 300 Metern ein. Erst zum Ansteuern eines Hafens oder Ankerplatzes dürfen wir wiederum senkrecht zum Ufer in langsamer Fahrt fahren.
Auf dem See halten wir, insbesondere bei leichtem Wind und wenig Welle, ausreichend Abstand während der Vorbeifahrt zu anderen Booten ein, seien es Segler oder stillliegende Boote (Achtung Badende!).
Wir passieren langsamere Boote nicht in voller Fahrt kurz vor dem Bug, sondern fahren hinten mit ausreichendem Abstand vorbei.
Wenn an schönen Tagen viele Wassersportler unterwegs sind, fahren wir nicht in Gleitfahrt im Slalom an den anderen vorbei. Wir fahren langsam durch dichte Felder mit Wassersportlern.
Wir vermeiden unnötigen Wellenschlag, im Hafen wie auf dem See. Der Wellenschlag ist oft individuell vom Bootstyp und der Geschwindigkeit abhängig. Besonders große Wellen machen Gleiter unterhalb ihrer Gleit-Geschwindigkeit bei 15 km/h.
Es gibt Gebiete mit dem Verkehrszeichen „Sog und Wellenschlag vermeiden“. Hier reduzieren wir die Geschwindigkeit so weit, bis wir fast keine Wellen mehr erzeugen, auch wenn man schneller fahren dürfte. Mit einem Blick nach achtern prüfen wir die von uns verursachten Wellen.
Regattafelder umfahren wir großzügig. Deren Begrenzung nach Luv und Lee sind durch große Bojen erkennbar. Segelboote in einer Wettfahrt erkennt man daran, dass sie keine Nationale am Heck gesetzt haben.
Als Segler haben wir unter Segeln, aber laufender Maschine, kein Wegerecht gegenüber anderen Booten.
Wasserskifahren, Wakeboarden, Banane schleppen usw. macht man idealerweise zu Tageszeiten, wo noch wenig Bootsverkehr ist. Hier ist genügend Abstand zu anderen Wassersportlern noch wichtiger.
Laute Musik, welche andere stört, unterlassen wir – beim Fahren wie auch beim Ankern. Denn unnötiger Lärm ruft nur Widerstand gegen die ganze Community hervor.
Wer wenig Fahrpraxis hat und bei Manövern im Hafen unsicher ist, kann sich an die Wassersportschulen wenden, die gerne auch individuelles Skipper-Training anbieten.
Ein Tipp zum Tanken
Immer mehr Seetankstellen bieten HVO-Diesel statt herkömmlichem Diesel an, einen nahezu klimaneutralen Kraftstoff (synthetischer Diesel). Mit diesem Kraftstoff ist auch die Gefahr einer Dieselpest im Tank an Bord gebannt. Auch für Benzin-Motoren wird an den Seetankstellen zunehmend klimafreundlicheres, nautisches E10 angeboten. Infos dazu unter: www.klimafreundlicher-bodensee.de
Wie macht man eine Bestandsflotte von vielen tausend Booten möglichst schnell klimafreundlich? Bis viele Motoren durch alternative Antriebsformen wie elektrisch oder Wasserstoff ersetzt sind, vergehen Jahrzehnte. Sofort wirksam sind dagegen alternative sogenannte Drop-in Kraftstoffe.
Mit dem Diesel Ersatzkraftstoff HVO kann man ohne jegliche Änderung an Boot oder Motor bis zu 90 Prozent neue Emissionen an CO2 einsparen. Bei Benzinkraftstoffen ist das nicht ganz so einfach. Der für den Bodensee entwickelte Kraftstoff Nautic E10 kann ebenfalls ohne Anpassung getankt werden und spart immerhin etwa 8,5 Prozent CO2-Neuemissionen.
Was ist HVO?
HVO ist die Abkürzung für Hydrotreated Vegetable Oil, also hydriertes Pflanzenöl.
Dieser Kraftstoff entspricht den Vorgaben der DIN EN 15940 für paraffinischen Dieselkraftstoff und kann in nahezu allen Dieselmotoren eingesetzt werden.
HVO wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen wie Abfällen (zum Beispiel alten Frittierfetten) und Reststoffen hergestellt.
HVO ist kein Biodiesel wie die bisher bekannten Rapsölprodukte, sondern ist eher als synthetischer Diesel zu bezeichnen.
Welche Vorteile hat HVO?
HVO spart aufgrund seiner Herstellung aus erneuerbaren Rohstoffen bis zu 90 Prozent CO2-Neuemissionen gegenüber fossilem Diesel ein. Dazu wird auch grüner Strom verwendet. HVO hat eine hohe Cetanzahl und ist deshalb ein hochwertiger Diesel Ersatzkraftstoff, der sehr effizient und sauber verbrennt. HVO enthält keine Schwefelverbindungen und keine aromatischen Kohlenwasserstoffe, ist daher nur in die Wassergefährdungsklasse WGK 1 eingestuft und biologisch abbaubar. HVO riecht nicht wie Diesel, sondern eher nach Wachs.
HVO ist immun gegen Dieselpest.
Kann ich HVO einfach so tanken und fahren?
Ja, HVO kann in jedem Verhältnis mit konventionellem Diesel gemischt werden. Um der Dieselpest den Garaus zu machen, sollte der Tank (sofern gewöhnlicher Tankstellen oder Biodiesel drin war) allerdings möglichst leer sein.
Wie lange hält sich HVO im Tank?
HVO altert deutlich langsamer als herkömmlicher Diesel – es ist also perfekt für Boote geeignet, die nur wenige Betriebsstunden haben und bei denen der Kraftstoff entsprechend lange im Tank bleibt.
Brauche ich ein Winter HVO?
Das an den Seetankstellen am Bodensee verkaufte HVO ist von vornherein für den Einsatz und die Lagerung im Winter geeignet.
Es ist bis minus 22 Grad Celsius kältebeständig.
Wo gibt es HVO?
An der Seetankstelle von Ultramarin in Kressbronn Gohren seit 2023, in Wallhausen (Bodenseenautic) und bei Konstanz im Seerhein am Pulverturm (Rudolf, ehemals MIZU). Die Schweizer Seetankstellen in Romanshorn (Fürst), Gottlieben (Kibag) und Bottighofen haben im Sommer 2025 ebenfalls HVO eingeführt.
Was kostet HVO?
HVO kostet etwas mehr als klassischer Diesel. Dafür spart man sich die Kosten für Zusatzstoffe gegen Dieselpest.
Gibt es genug HVO für alle Dieselmotoren am Bodensee?
Die Lieferanten könnten sämtliche Tankvolumina am Bodensee mit HVO versorgen.
Was ist Nautic E10?
Nautic E10 ist ein Otto Kraftstoff (Benzin), der in Deutschland speziell für Motorboote auf dem Bodensee entwickelt wurde.
Er enthält genau zehn Prozent Ethanol aus pflanzlichen Rest und Abfallstoffen, die nicht für die Verwendung in der Lebensmittelproduktion geeignet sind. Die Oktanzahl beträgt mindestens 95 ROZ (analog zum Schweizer Kraftstoff Bleifrei 95).
Die Verbrennung im Motor wird durch das Bioethanol sauberer und schadstoffärmer, die Emission von fossilem CO2 verringert sich.
Additive, um die vom Kraftstoff angezogenen Wassermoleküle zu binden, werden beim Mischen des Kraftstoffs bereits zugesetzt.
Dank eines speziellen Additivs garantiert der Hersteller eine einjährige Lagerstabilität.
Wieviel CO2 spart Nautic E10 ein?
Verglichen mit rein fossilem Otto Kraftstoff werden etwa 8,5 Prozent CO2 Emissionen eingespart, da die enthaltenen zehn Volumenprozent Ethanol aus pflanzlichen Rohstoffen stammen, die vorher CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen haben.
Die etwas aufwändigere Produktion ist dabei bereits berücksichtigt.
Wo gibt es Nautic E10?
Seit Sommer 2025 ist Nautic E10 an den drei deutschen Seetankstellen – Ultramarin in Kressbronn Gohren, Bodenseenautic in Wallhausen und Rudolf am Seerhein in Konstanz – statt Benzin beziehungsweise Super E5 erhältlich.
Wer kann Nautic E10 tanken?
Für etwa 90 Prozent der Ottomotoren auf dem Bodensee gibt es Freigaben der Hersteller (siehe Betriebsanleitung) für Kraftstoff mit bis zu zehn Prozent Ethanol. Es empfiehlt sich, einen Kraftstofffilter mit Wasserabscheider einzubauen. Ob man bei älteren Motoren die Dichtungen der Kraftstoffleitungen ersetzen sollte, kann die Servicewerkstatt beurteilen.
Impressum:
V.i.S.d.P: Martin Lepple
Geschäftsstelle IBMV
Martin Lepple
Schulstrasse 5
72657 Altenriet
www.ibmv.com